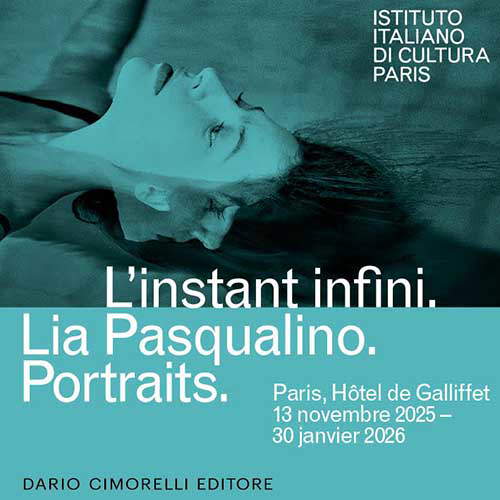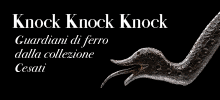Rom, der Salone di Pietro da Cortona im Palazzo Barberini wird umgestaltet
Im Palazzo Barberini in Rom wurde der Salone Pietro da Cortona renoviert: An den Wänden hängen nun die vorbereitenden Karikaturen für den Zyklus des Lebens von Urban VIII. aus dem 17. Jahrhundert, die zum ersten Mal im Dialog mit dem Deckenfresko von Pietro da Cortona gezeigt werden.
By Redazione | 14/05/2025 11:55
In Rom präsentieren die Gallerie Nazionali di Arte Antica (Nationale Galerien für Antike Kunst ) die Neuausstattung des Salone Pietro da Cortona im Palazzo Barberini: Dieser majestätische Raum, eines der repräsentativsten Symbole des römischen Barocks, öffnet sich dem Publikum mit einem völlig erneuerten Aussehen, das der Stadt eine ihrer emblematischsten Umgebungen in voller historischer und künstlerischer Kohärenz zurückgibt.
Dreh- und Angelpunkt der Intervention ist die Verlegung der vorbereitenden Karikaturen des Zyklus Das Leben Urbans VIII., einer Reihe von Werken von außerordentlichem Wert, die in dem ursprünglichen Kontext präsentiert werden, für den die Wandteppiche konzipiert wurden, die von eben diesen Karikaturen abgeleitet wurden. Nach jahrzehntelanger Abwesenheit von der Ausstellungsszene und dank der sorgfältigen Restaurierungsarbeiten, die vom Labor der Nationalgalerie durchgeführt wurden, sind die Karikaturen wieder in dem großen Saal zu sehen, den Pietro da Cortona zwischen 1632 und 1639 mit dem berühmten Triumph der göttlichen Vorsehung ausmalte, in einem visuellen und konzeptionellen Dialog, der die Pracht der Barockkunst hervorhebt.
Diese Operation, die das Ergebnis einer strengen philologischen Studie ist, beschränkt sich nicht auf eine museale Ausstellung, sondern ist als eine Art historische Wiederherstellung gedacht. Zum ersten Mal werden die Karikaturen in einem Rahmen gezeigt, der an die ursprüngliche Funktion des Salons erinnert: eine Umgebung, die dazu bestimmt war, die Macht und den Ruhm der Familie Barberini zu feiern, einer der einflussreichsten Familien im Rom des 17. Der Salon wird so wieder zu einem Ort der Repräsentation im Sinne des 17. Jahrhunderts und erhält den von seinen Auftraggebern gewünschten Sinn für figuratives Erzählen zurück.



Das Projekt hat seine Wurzeln in einem der faszinierendsten künstlerischen Ereignisse im Rom des 17. Es war Kardinal Francesco Barberini, Neffe von Papst Urban VIII, der 1627 die Manifattura Barberini, eine der ersten Tapisserien in Rom, ins Leben rief. Ausgangspunkt war eine Geste von großer politischer und symbolischer Bedeutung: ein Geschenk des französischen Königs Ludwig XIII. in Form von sieben Wandteppichen nach Entwürfen von Rubens. Dieses Geschenk von unschätzbarem Wert regte den Kardinal dazu an, einen neuen Zyklus von Festteppichen zu schaffen, die dem Leben seines Onkels, des Papstes, gewidmet sein sollten. Die Absicht war eine doppelte: das Prestige der Familie Barberini zu stärken und zum Aufbau eines öffentlichen Bildes des Papsttums beizutragen, das von Pracht geprägt war.
Der Zyklus Das Leben Urbans VIII. ist das Ergebnis dieser Vision. Es handelt sich um ein monumentales Werk, in dem die Biografie des Papstes mit religiösen und politischen Allegorien in einer visuellen Erzählung verwoben ist, die nicht nur das Papsttum, sondern auch die Dynastie, die es repräsentiert, verherrlicht. Die vorbereitenden Karikaturen wurden den Künstlern aus dem Umkreis von Pietro da Cortona anvertraut (Antonio Gherardi, Fabio Cristofani, Giuseppe Belloni, Pietro Locatelli, Giacinto Camassei), die lebensgroße Zeichnungen anfertigten, die durch die komplexe Technik des "basso liccio", die bei der Herstellung verwendet wurde, in Stoff umgesetzt werden sollten. Entgegen der üblichen Praxis beschloss die Familie Barberini, diese Karikaturen zu bewahren, da sie ihren künstlerischen Wert sofort erkannte, und stellte sie stolz in den Räumen ihres Palastes aus.



Seit mehr als drei Jahrhunderten bevölkern diese Werke die Räume des Palazzo Barberini und sind fester Bestandteil der visuellen und kulturellen Identität des Gebäudes. Im Laufe der Zeit wurden sie jedoch aus konservatorischen Gründen und aufgrund musealer Umgestaltungen entfernt, so dass sie nur noch eine marginale Rolle spielten. Heute stehen die Karikaturen dank der Wiederherstellung, Restaurierung und Erforschung wieder im Mittelpunkt des Interesses und ermöglichen es dem Publikum, in einen der höchsten Ausdrucksformen der Barockkunst einzutauchen .
Die Neugestaltung des Salons zielt darauf ab, eine neue und kohärente Interpretation des gesamten dekorativen Programms vorzuschlagen, um dem Besucher die Möglichkeit zu geben, die komplexe Verflechtung von Malerei, Weberei, Architektur und politischer Propaganda zu begreifen. Die gleichzeitige Präsenz der Deckenfresken und der Karikaturen an den Wänden ermöglicht eine Gesamtschau, die der Einheit des ursprünglichen Projekts gerecht werden soll.