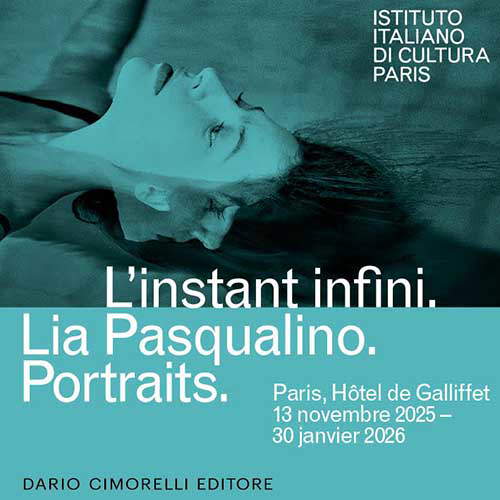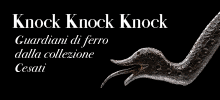Jüdisches Ferrara, 10 Orte, die man kennen sollte
Eine Reise durch zehn symbolträchtige Orte in Ferrara, um die tausendjährige Geschichte der jüdischen Gemeinde, ihre Traditionen, dramatischen Ereignisse und ihren Beitrag zur Kultur der Stadt zu entdecken.
By Redazione | 07/08/2025 16:17
Ferrara ist Hüterin einer außerordentlich reichen und komplexen jüdischen Geschichte, die ihre Wurzeln im 13. Jahrhundert hat und das städtische und kulturelle Gefüge der Stadt bis heute unauslöschlich prägt . Die jüdische Präsenz in Ferrara ist seit dem Mittelalter ununterbrochen bezeugt, und die jüdische Gemeinde ist bis heute eine der ältesten und einflussreichsten in Italien. Das goldene Zeitalter war die Zeit des Herzogtums der Familie Este, als sich der Hof der Este und insbesondere die Herzöge Ercole I. und Ercole II. durch eine Politik der großzügigen Gastfreundschaft auszeichneten, indem sie zahlreichen jüdischen Intellektuellen Zuflucht gewährten, insbesondere denen, die 1492 aus Spanien flohen. Diese Zeit war durch einen fruchtbaren kulturellen Dialog zwischen den Juden und der christlichen Mehrheitskultur gekennzeichnet.
Doch die Geschichte war nicht immer von Toleranz geprägt. Mit der Übergabe Ferraras an den Kirchenstaat im Jahr 1597 änderte sich die Situation grundlegend. Nach dem Erlass verschiedener Edikte wurde 1624 mit dem Bau des jüdischen Ghettos begonnen, das einige Jahre später den etwa 1.500 in der Stadt lebenden Juden auferlegt wurde. Von 1627 bis zur Vereinigung Italiens wurde die jüdische Gemeinde abgesondert und von der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung in die totale Isolation gezwungen, mit zeitweiligen Toleranzperioden. Die tragische Rückkehr des Ghettos kam mit den Rassengesetzen von 1938, die schreckliche Verfolgungen auslösten, die in der Zerstörung von Eigentum und der Deportation von fast 200 Juden zwischen 1941 und 1945 gipfelten.
Trotz der Schwierigkeiten und Tragödien war die jüdische Gemeinde von Ferrara weiterhin aktiv und trug zur Geschichte und Kultur der Stadt bei. Ihr Erbe wird heute durch einen Rundgang, der historische, religiöse und Gedenkstätten umfasst, erzählt und aufgewertet. Wer diese faszinierende Geschichte der Identität, der Erinnerung und der Integration kennenlernen möchte, dem bietet ein Podcast, der von der Stadtverwaltung Ferrara mit Unterstützung von Destinazione Turistica Romagna und in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Ferrara, dem Institut für Zeitgeschichte und dem MEIS produziert wurde, einen intimen und ausführlichen Einblick. Nachstehend die 10 Orte, die man gesehen haben muss , um die Geschichte des jüdischen Ferrara kennen zu lernen.
1. Das jüdische Ghetto
Das mittelalterliche Viertel von Ferrara bewahrt noch heute die Erinnerung an das alte jüdische Ghetto, in dem die Gemeinde von 1627 bis zur Vereinigung Italiens untergebracht war. Die Hauptstraße dieses historischen Viertels war die Via Mazzini, in der sich einst die jüdischen Geschäfte und sozialen Aktivitäten befanden und die noch immer ihre ursprüngliche Struktur bewahrt hat. Am Eingang der Via Mazzini, in Richtung Piazza della Cattedrale, befand sich eines der fünf Tore, die das Viertel abriegelten, und eine Gedenktafel zwischen zwei Bögen erinnert an die Gründung des Ghettos.
Neben der Via Mazzini bildeten auch die Via Vignatagliata, die Via Vittoria und die Piazzetta Isacco Lampronti das Herzstück des jüdischen Viertels. Wenn man durch diese Straßen schlendert, kann man alte Terrakotta-Gebäude sehen, die teils einfach, teils mit reich verzierten Portalen oder schmiedeeisernen Balkonen geschmückt sind. In diesem Viertel befanden sich auch die jüdische Schule, in der Giorgio Bassani während der Rassentrennung unterrichtete, der alte Ofen für ungesäuertes Brot, der Kindergarten und das Hospiz. Die Einrichtung des Ghettos wurde vom Kirchenstaat verhängt, nachdem er 1597 die Kontrolle über die Stadt zurückerlangt hatte. Mit den Rassengesetzen von 1938 wurde das Ghetto wieder in Betrieb genommen, was für die Gemeinde eine Zeit schrecklicher Verfolgung bedeutete. Durch diese Straßen zu gehen bedeutet, den fruchtbaren kulturellen Dialog zwischen den Juden und der Mehrheitskultur zu erforschen, aber auch die Erinnerungen an eine schwierige Vergangenheit zu berühren, die auch in den Geschichten von Giorgio Bassani weiterlebt.

2. Der Synagogenkomplex
Der Synagogenkomplex befindet sich in der Via Mazzini, Nummer 95, im Herzen des alten Ghettos. Die Geschichte dieses heiligen Ortes geht auf das Jahr 1485 zurück, als der römische Bankier Ser Samuel Melli ein großes Haus kaufte und es der jüdischen Gemeinde von Ferrara schenkte, um es zum Sitz ihrer Institutionen zu machen. Im Inneren des Gebäudes befinden sich drei Synagogen. Bis 2012 beherbergte es auch das Jüdische Museum im zweiten Stock des Gebäudes. Derehemalige deutsche (aschkenasische) Tempel, die größte Synagoge, wird noch immer für die feierlichsten Zeremonien genutzt. Mit fünf Fenstern, die den Raum von einem Innenhof aus beleuchten, und großen Stuckmedaillons mit allegorischen Darstellungen aus dem Levitikus verfügt der Raum über einen Aron (einen heiligen Schrank) aus dunklem Holz aus dem 17. Derehemalige italienische Tempel ist heute ein Saal, der für Konferenzen und Gemeindefeiern genutzt wird und in dem drei wertvolle Arons aus dem 18. DasOratorium Fanese, ein kleines Gotteshaus aus dem 19. Jahrhundert, wird für Sabbatriten genutzt. Seine Tür stammt aus der Synagoge von Cento, und das Innere ist mit Stuck verziert, mit einer markanten Kanzel aus dem 19. Die Synagogen wurden während des Zweiten Weltkriegs geplündert und verwüstet, insbesondere 1941 und während der Nazi-Besetzung 1943-44, als die Scola Italiana sogar als Konzentrationslager genutzt wurde. Der Komplex ist seit 2012 für Restaurierungsarbeiten geschlossen.

3. Das MEIS - Nationalmuseum für das italienische Judentum und die Shoah
Das MEIS - Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (Nationalmuseum des italienischen Judentums und der Shoah) befindet sich in Ferrara, Via Piangipane, 81. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die über zweitausendjährige Geschichte des Judentums in Italien von den Anfängen bis zur Gegenwart zu erzählen. Das Museum erzählt von den Phasen der Integration und des kulturellen Austauschs, aber auch von den schwierigen Perioden, die von Verfolgung und Isolation geprägt waren, und hebt eine gemeinsame Erfahrung hervor, die alle betrifft. Das MEIS dient auch als Ort des Gedenkens und der Reflexion über die Shoah und fördert den interkulturellen Dialog und den Wert der Vielfalt.
Die Wahl Ferraras als Veranstaltungsort ist nicht zufällig: Die Stadt verkörpert die vielfältigen Erfahrungen der tausendjährigen Geschichte der italienischen Juden, die durch eine untrennbare Beziehung zur Stadt gekennzeichnet ist, die in der Willkommenspolitik des Hauses Este gipfelte, dann aber von der Errichtung des Ghettos und der nationalsozialistisch-faschistischen Verfolgung überschattet wurde. Das Museum, das 2011 eröffnet wurde, zeigt traditionelle und religiöse Gegenstände, zahlreiche Bücher und Dokumente, die die Geschichte der Gemeinde Ferrara rekonstruieren. Nach dem Erdbeben von 2012 wurde ein Großteil des Materials, das zuvor im Jüdischen Museum im Synagogenkomplex in der Via Mazzini ausgestellt war, in das MEIS übertragen. Die Ausstellung umfasst Dokumentationen zu den verschiedenen Aspekten des jüdischen Lebens, von der Geburt bis zur Heirat und den Momenten des religiösen und gemeinschaftlichen Gottesdienstes.

4. Die ehemalige jüdische Schule
In der Via Vignatagliata, Nummer 33, befindet sich das Gebäude, in dem die ehemalige jüdische Schule von Ferrara untergebracht war. Dieser Ort stellt ein wichtiges Stück in der Geschichte der jüdischen Gemeinde von Ferrara dar, da er einen Einblick in die Besonderheiten der jüdischen Erziehung bietet, bei der Tradition und Moderne miteinander verwoben wurden, um neue Generationen zu erziehen. Dieses mittelalterliche Gebäude, das ursprünglich als Kindergarten und Grundschule diente, spielte nach der Verabschiedung der Rassengesetze im Jahr 1938 eine entscheidende Rolle. Infolge dieser diskriminierenden Vorschriften wurde die Schule zum einzigen Ort, an dem alle jüdischen Schüler und Lehrer in Ferrara ihre Ausbildung fortsetzen konnten.
Zu den Lehrern gehörte damals auch der junge und frischgebackene Absolvent Giorgio Bassani, der während der Rassentrennung unterrichtete. Die Schule bot ein ausgewogenes Verhältnis zwischen religiösem und weltlichem Wissen und kombinierte das Studium der Thora und des Hebräischen mit klassischen Fächern. Diese Einrichtung war von grundlegender Bedeutung für die Vermittlung von Werten, kultureller Identität und Weltoffenheit. Ihr Betrieb wurde 1943 mit der Verhaftung der Lehrer, darunter Bassani, und der anschließenden Schließung der Einrichtung unterbrochen. Ein Besuch an diesem Ort vermittelt einen Einblick in die Einzigartigkeit eines Bildungssystems, das die Bewahrung der kulturellen Identität mit der Fähigkeit, sich der Welt zu öffnen, zu verbinden vermochte.

5. Das Haus von Isacco Lampronti
Ebenfalls in der Via Vignatagliata Nr. 33 befindet sich das Haus von Isacco Lampronti (Ferrara, 1679 - 1756), einem berühmten Rabbiner und Arzt aus dem 18. Jahrhundert, dessen Bedeutung für die jüdische Gemeinde von Ferrara durch zwei Gedenktafeln in derselben Straße bezeugt wird. Lampronti ist berühmt für sein monumentales Werk, den Pachad Yitzchak, eine halachische Enzyklopädie, die Generationen von Gelehrten tiefgreifend beeinflusst hat. Sein Beitrag zur jüdischen Rechtswissenschaft war bedeutend und zeichnete sich durch eine seltene Kombination aus traditionellem Wissen und wissenschaftlichem Ansatz aus. Isacco Lampronti war nicht nur eine prominente religiöse und akademische Persönlichkeit, sondern auch ein engagierter Pädagoge und ein Bürger, der sich aktiv am gesellschaftlichen Leben in Ferrara beteiligte. In einer Zeit tiefgreifenden Wandels strebte sein Denken nach einer harmonischen Verbindung von Glauben, Kultur und Wissenschaft und war ein Beispiel für Gelehrsamkeit und Modernität. Das Kennenlernen der Figur Lampronti durch sein Haus und sein intellektuelles Vermächtnis bietet eine einzigartige Perspektive auf das lebendige jüdische Kulturleben in Ferrara im 18. Jahrhundert und die Bedeutung der Weitergabe von Wissen von Generation zu Generation.

6. Die Borso d'Este-Säule
Die Säule von Borso d'Este, die sich auf dem Domplatz befindet, birgt eine wenig bekannte, aber sehr bedeutende Geschichte, die das Denkmal mit der örtlichen jüdischen Gemeinde verbindet. Die zu Ehren des Herzogs Borso errichtete Säule wurde aus dem Material der Gräber eines alten jüdischen Friedhofs gebaut. Dieses Ereignis, das auf Veranlassung der Inquisition im 18. Jahrhundert stattfand, wirft komplexe Fragen über das Verhältnis zwischen Macht, Erinnerung und Respekt vor Minderheiten auf. Die Affäre ist ein Beispiel dafür, wie die offizielle Geschichte manchmal Spuren anderer Kulturen und Erinnerungen überlagern und auslöschen kann.
Dennoch hat Ferrara beschlossen, diese Episode nicht zu vergessen, und zwar so sehr, dass eine Gedenktafel angebracht wurde, um den Wunsch der Stadt zu symbolisieren, die Beziehungen zur jüdischen Kultur Ferraras wiederherzustellen. Die Säule, auf der der Borso d'Este steht, mit ihren Schichten von jüdischen Grabsteinen aus den alten Friedhöfen der Stadt, ist eine stille Erinnerung, die uns dazu einlädt, über die Ereignisse der Vergangenheit und das Zusammenleben der verschiedenen Gemeinschaften in der Stadt nachzudenken. Es ist ein Ort, der zu einer Reise durch die Geschichte, die Erinnerung und die Kontroversen einlädt, die das kulturelle Erbe Ferraras geprägt haben.

7. Das Muretto des Castello Estense
Das Muretto del Castello Estense im Corso Martiri della Libertà ist der symbolische Ort desMassakers vom 15. November 1943, das auch als Massaker am Castello Estense bekannt ist. ist eine der dramatischsten und brutalsten Episoden in der Geschichte Ferraras während der faschistischen Besetzung. Bei diesem tragischen Ereignis wurden elf unschuldige Zivilisten, darunter mehrere Juden, als Vergeltung für die Ermordung von Igino Ghisellini, dem Federale von Ferrara, zwei Tage zuvor getötet. Unter den Opfern befand sich auch Girolamo Savonuzzi, der damalige Chefingenieur der Stadtverwaltung von Ferrara.
Die Nachricht vom Tod Ghisellinis, dessen Umstände noch immer umstritten sind, löste eine sofortige Reaktion von Alessandro Pavolini auf dem Kongress der Republikanischen Faschistischen Partei in Verona aus, der eine Vergeltungsmaßnahme in Ferrara anordnete. Faschistische Trupps trafen in der Stadt ein und verhafteten am Abend des 14. November 74 Bürger von Ferrara, die als Antifaschisten oder Regimegegner galten. Im Morgengrauen des 15. November wurden zehn von ihnen vor der niedrigen Mauer des Estense-Schlosses und auf den Mauern in der Nähe der Rampari di San Giorgio erschossen. Ein elfter Zivilist, Cinzio Belletti, wurde in der Via Boldini ermordet, weil er nicht an der Haltestelle angehalten hatte. Die Leichen der Opfer wurden zur Warnung ausgestellt, bevor sie dank der Intervention des Erzbischofs Ruggero Bovelli entfernt wurden. Diese Episode, die von einigen Historikern als das erste Bürgerkriegsmassaker in Italien angesehen wird, wird von Giorgio Bassani in der Kurzgeschichte Una notte del '43 (Eine Nacht im Jahr 1943 ) erzählt und in dem Film La lunga notte del '43 von Florestano Vancini wiedergegeben. Vier Gedenktafeln an der kleinen Mauer und an den Zugangssäulen zum Burggraben erinnern an dieses Ereignis.

8. Der Jüdische Friedhof
Der Jüdische Friedhof in der Via delle Vigne, Nummer 22, ist für die jüdische Gemeinde von Ferrara ein Ort voller Geschichte, Erinnerung und tiefer Spiritualität. Er ist einer der ältesten noch genutzten jüdischen Friedhöfe Italiens, wobei die ersten Grabsteine auf einen Ursprung im 16. Jahrhundert hinweisen, obwohl das Gelände erst 1626 offiziell erworben wurde. Der Friedhof ist ein greifbares Symbol für die jüdische Präsenz in der Stadt und beherbergt die Gräber berühmter Persönlichkeiten, darunter das des Schriftstellers Giorgio Bassani, der mit einem von Arnaldo Pomodoro und Piero Sartogo geschaffenen Denkmal geehrt wird.
Der Friedhof, der durch ein Jugendstilportal aus dem Jahr 1912 zugänglich ist, ist in fünf Hauptbereiche unterteilt, die die verschiedenen Erwerbungen im Laufe der Zeit widerspiegeln. Man findet hier Bestattungen aus jüngerer Zeit, Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert, einen Bereich, der den Opfern der Deportationen gewidmet ist, und Spuren eines Bereichs aus dem 18. Jahrhundert, der von der Zerstörung durch die Inquisition geprägt ist. Von den etwa 800 Grabsteinen tragen viele Inschriften auf Hebräisch, Italienisch oder zweisprachig. Dieser stille und kontemplative Ort inspirierte Bassani selbst, der ihn in seinem Roman Gli occhiali d'oro (Die goldenen Gläser) bewegend beschrieb, da er in ihm eine tiefe Ruhe empfand. Hier platzierte Bassani in seiner literarischen Neuerfindung auch das monumentale und stilistisch eklektische Grabmal der berühmten Familie Finzi-Contini, ein Symbol ihrer Bedeutung und der komplexen Wechselfälle der Gemeinde.

9. Haus Bassani
Das Bassani-Haus in der zentralen Via Cisterna del Follo ist das ehemalige Herrenhaus, in dem Giorgio Bassani zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern seine Kindheit und Jugend verbrachte. Dieser intime Ort, der tief in der Biografie des Schriftstellers verwurzelt ist, war ein Schmelztiegel für seine Poesie und sein hohes bürgerliches Engagement, woran eine 2009 von der Stadt Ferrara angebrachte Tafel erinnert. Bassani verließ dieses Haus im Mai 1943, als er wegen seiner antifaschistischen Aktivitäten verhaftet wurde; nach seiner Entlassung und seinem Untertauchen schloss sich seine Familie, die sich vor den deutschen Razzien in einem Kleiderschrank versteckt hatte, ihm in Florenz an und kehrte nach dem Krieg nach Ferrara zurück. Berühmt ist das Haus auch für den großen Magnolienbaum, der aus der den Innengarten umgebenden Mauer herausragt, ein Baum, der in Bassanos berühmtem Gedicht Die Rassengesetze eine starke symbolische Bedeutung erhält.
Auch wenn Bassani in einigen seiner Werke, wie z. B. in Dietro la porta (Hinter der Tür), das Haus in der Via Scandiana platziert, ist das Gebäude in der Via Cisterna del Follo der eigentliche und phantasievolle Mittelpunkt seiner Produktion. Das Haus und sein Garten mit den hohen Mauern und der Hausschildkröte wurden für Bassani zu einem Grenzort zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Mysterium, zu einer Quelle von Träumen und Albträumen. Es waren [...] die Blicke, die von den höchsten Fenstern des Hauses, von den kühnsten Dachgauben herabgeworfen wurden, um ein Geheimnis zu erhaschen, in denen wir mit unserer ganzen Seele lebten", schrieb Bassani in seinen Tagebüchern.

10. Spanische Schule
Die Spanische Schule in der Via Vittoria ist ein bedeutendes Zeugnis für den Reichtum und die Vielfalt der Synagogen, die Ferrara bevölkerten. Im 16. Jahrhundert zählte die Stadt mindestens zehn öffentliche und private Synagogen, die in verschiedenen Straßen verstreut waren. Die sephardischen Juden, die als "Spanier und Levantiner" bekannt waren, kamen 1492 auf Einladung des Herzogs Ercole I. d'Este nach ihrer Vertreibung aus Spanien nach Ferrara. Da sie als "Nation" angesehen wurden, die sich von der päpstlichen Verwaltung gegenüber den italienischen und deutschen Juden unterschied, durften sie ihre eigene Synagoge, die Scola Spagnola, in der Via Gattamarcia (heute Via della Vittoria, 41) unterhalten. Dieses Privileg wurde auch dann beibehalten, als die päpstliche Gesetzgebung von 1620 das Vorhandensein von nur einer Synagoge in der Stadt vorschrieb, was zur Schließung anderer privater Bethäuser führte.
Tragischerweise wurde die Spanische Schule, wie auch andere Synagogen in Ferrara, 1944 von den Nazifaschisten verwüstet. Heute ist die Synagoge geschlossen, und ein Teil ihrer Einrichtung wurde an einen anderen Ort verlegt. Dank einer Fotodokumentation konnten ihre Merkmale rekonstruiert werden: verzierte Wände, eine große Aron an der Ostwand und eine von der Aron getrennte Bimah (eine Art Kanzel), die dem Heck eines Schiffes ähnelt und von der aus der Rabbiner die Gemeinde leitete. Eine Tafel an der Außenwand erinnert an die Einladung von Herzog Herkules I. im Jahr 1492 und die Zerstörung der Synagoge im Jahr 1944, die ein Symbol für die Verbreitung der sephardischen Kultur in Italien und Europa ist.