Einfach, unpersönlich, schweigsam, sogar offensichtlich. Doch hinter dem unbetitelten Titel vieler Kunstwerke - der meisten, denn das Betiteln ist eine recht junge Erfindung - weht das Banner einer Suche, die sich stolz von der Herrschaft der Worte, vom Joch der Literatur befreit hat. Mit Legionen von Malern, die im Namen der Kunst um der Kunst willen auf den Titel ihrer einzelnen Werke verzichtet haben. Und im Namen des Wunsches, dem Publikum ein Werk anzubieten, das offen für die möglichen Interpretationen anderer ist. In der heutigen Zeit der programmierten Planung des künstlerischen Produkts, der Dominanz des Inhalts (besser, wenn er engagiert ist) über die Form, der Flankierung (wenn nicht Überschneidung) der Figur des Künstlers durch Marketing- und Kommunikationsexperten, die dazu gedrängt und/oder gezwungen werden, ihr Werk mit einem Branding zu versehen, um es als Produkt zu identifizieren, mag die aseptische und asketische Praxis derjenigen - und es gab viele - im 20. Jahrhundert, die das, was aus ihrem Atelier kam, mit einem Nicht-Titel betitelten, wie eine schrille Note klingen. Das Buch von Chiara Ianeselli mit dem Titel Sulla necessità del Senza titolo (Über die Notwendigkeit des Untitels ) ist diesem Kampf des Bildes gegen das Wort gewidmet, das es synthetisiert und einsperrt, einem Kampf, an dem Maler wie Mirò und Picasso beteiligt waren, aber vor allem die Protagonisten der so genannten New York School und damit die Autoren des Arte Povera-Epos (1967-1971). Das Schweigen als Sprache der Kunst (Postmedia, 2025, 133 Seiten, 16 Euro).
Die junge Kunsthistorikerin und Kuratorin aus Trient, die derzeit eine Stelle am Maxxi in Rom innehat, hat den Kern und das Beste ihrer Doktorarbeit (deren didaktischen Ansatz und Gliederung sie auch beibehält) über Titel in Kunstwerken veröffentlicht. Ihr Buch zeichnet sich durch eine umfangreiche Bibliographie aus, die vor allem reich an Zitaten aus amerikanischen Sachbüchern ist, denen sie unveröffentlichte Zeugnisse hinzufügt, die sie im Dialog mit den Überlebenden jener Zeit gesammelt hat, die in vielerlei Hinsicht bewusst “aphonisch” war (Interviews mit den armen Künstlern Anselmo, Paolini, Piacentino, Penone) und die in den 1980er Jahren durch die Rückkehr zur Malerei (Transavanguardia, Pittura colta, anacronisti) durch die Wiederbelebung wissenschaftlicher und literarischer Zitate in Titeln verdrängt wurde.
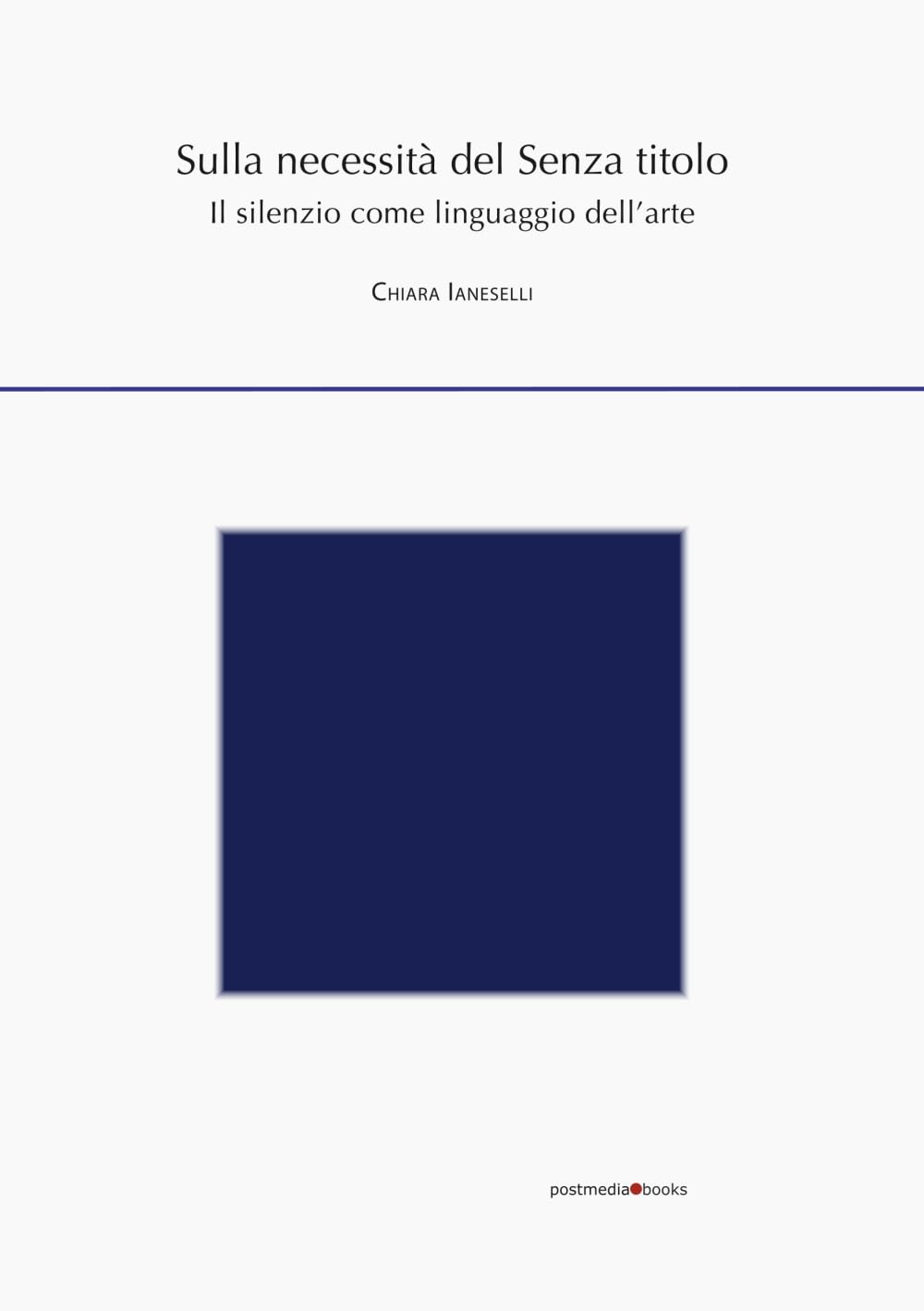
Doch jahrhundertelang kam das Kunstwerk ohne einen Titel aus. Das Thema, ob es sich nun um ein Gemälde für einen religiösen oder profanen Auftrag handelte, definierte das einzelne Werk. Und die Allgemeinheit oder Allgemeingültigkeit des Themas (Madonna mit Kind und Heiligen) wurde zur Identifizierung durch eine genaue Beschreibung kompensiert. Es genügt, auf das Rechnungsbuch von Lorenzo Lotto zu verweisen, in dem am 10. Februar 1545 der Eingang von 16 Dukaten als Bezahlung für das intensive Vesperbild vermerkt ist, das sich heute in der Galerie Brera befindet und das der venezianische Maler genau (aber nicht lapidar) als “pictura de una paleta [...] fatta per una pietà, la Vergine tramortita in brazo de San Joanne et Jesu Cristo morto nel gremio de la matre, et due anzeleti da capo e piedi sustentar el nostro signore...”. Sicher ist jedoch, dass Peruginos populäres und mythisches Gemälde, das sich heute im Louvre befindet, seinen eigenen Titel trägt: Kampf zwischen Liebe und Keuschheit. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass Isabelle d’Este in ihrem Vertrag mit dem Maler aus dem Jahr 1503 für das Werk, das in ihrem Studiolo in Mantua aufgestellt werden sollte, darum bat, oder vielmehr Vannucci darum bat, “una batagla (sic.) der Keuschheit gegen Lascivia, d.h. Pallas und Diana kämpfen mannhaft gegen Venus und Amor”. Einige Jahre später, vor seinem Tod im Jahr 1510, schuf Giorgione sein wohl berühmtestes Gemälde, ohne eine Signatur oder einen Titel zu hinterlassen: Der Sturm", wie Marcantonio Michiel es viele Jahre später, 1530, nannte, das “kleine Dorf” der “Zorzi de Castelfranco”, wie es im Haus von Gabriele Vendramin zu sehen ist und wie wir es heute in der Gallerie dell’Accademia in Venedig bewundern können.
Das Aufkommen des Sammelns und die damit verbundene Notwendigkeit, Inventare von Sammlungen zu erstellen, haben vor allem im 19. und 20. Jahrhundert unter dem Antrieb der Händler, die an leicht identifizierbaren und vermarktbaren Produkten interessiert waren, dazu geführt, dass Titel und Literatur rund um den Diskurs über (nur) Bilder von Malern aufblühten. So wurde der Titel unter dem Einfluss des Symbolismus und dann des Surrealismus, aber auch des Futurismus, d.h. der Bewegungen mit der größten literarischen Bedeutung, “zu einem wirklichen Namen, den das Werk mit sich trägt”, stellt Ianeselli in seinen einleitenden Bemerkungen fest, “und der oft die Identität und das Verständnis des Dargestellten bestimmt. Oftmals sogar eingeschrieben, manchmal vom Künstler selbst eingraviert oder in die Bildunterschriften eingefügt, begleiten die Titel das Werk wie echte Taufscheine”. Wie sonst könnte man das Gemälde von De Chirico in der Mattioli-Sammlung (Museo del Novecento) in Mailand L’enigme dell’heure nennen, wenn nicht L’enigme dell’heure, da der pictor optimus es so betitelt hat und es auf dem Rahmen seines metaphysischen Meisterwerks eingeprägt hat?




Doch schon im 19. Jahrhundert gab es diejenigen, die sich gegen die Dominanz des Wortes, gegen den eindeutigen Inbegriff auflehnten. Ianeselli berichtet in einer langen Notiz auf Seite 36 von der Verärgerung James Wistlers darüber, dass die Verfasser des Katalogs zu seinem musikalischen Arrangement in Grau und Schwarz, das 1872 an die Accademia geschickt wurde, den ursprünglichen Titel des Künstlers um den Zusatz: Porträt der Mutter des Malers erweitert hatten. “Aber was kann oder sollte das Publikum an der Identität des Porträts interessiert sein”, fragte sich der große englische Maler und fügte hinzu: “Wie die Musik die Poesie des Klangs ist, so ist die Malerei die Poesie des Sehens, und das Thema hat nichts mit der Harmonie von Klang und Farbe zu tun”. Die Galeristen und Händler drängten und drängen jedoch auf einen Namen, der das Werk einzigartig und leicht identifizierbar und vermarktbar macht. Im Falle Picassos zum Beispiel die legendären Kahnweiler und Vollard, mit der daraus resultierenden, aber verspäteten Rebellion des Malagueño, der 1946 erklärte, dass er seine Werke nicht benenne, und sich über “die Manie der Kunsthändler” und “der Kritiker”, aber auch “der Sammler, Bilder zu taufen” empörte.
Ianesellis Buch ist reich an Zitaten der Protagonisten und auch für ein nicht fachkundiges Publikum unterhaltsam. Es konzentriert sich bei der Artikulation und Argumentation des Diskurses Über die Notwendigkeit des Unbenannten auf den abstrakten Expressionismus und den Minimalismus aus den USA, dann auf die italienische Arte Povera. Der drastischste und wütendste Verteidiger seiner Bilder, die “namenlos bleiben, wie es sich gehört”, weil “sie nicht vom Leben handeln”, sondern “ein Eigenleben führen”, scheint unter den amerikanischen Abstrakten Expressionisten Clyfford Still zu sein. Nachdem Peggy Guggenheim den Gemälden, die 1946 in der Galerie Art of This Century ausgestellt und zum Verkauf angeboten wurden, Titel wie Buried Sun und The Comedy of Tragic Deformation gegeben hatte, entfernte Still ab 1959 alle nicht von ihm stammenden Titel von den alten Werken und benannte die neuen nicht mehr, außer durch ein System von Buchstaben und Nummern, um sie erkennbar zu machen. Die Nummer war im Übrigen das System, das unter anderem von William Baziotes, Jackson Polloick und Mark Rothko verwendet wurde, der ab 1948 begann, seine Gemälde mit Untitled zu betiteln (fast 150 seiner Werke mit dieser Definition, wie sein Sohn Christopher untröstlich feststellte, als er sich mit dem Archiv seines Vaters auseinandersetzte), um im folgenden Jahrzehnt, ab 1955, die Farben im Gemälde hinzuzufügen.
Ad Reinhardts Kunst um der Kunst willen gegen die Kunst als Ware brachte die fundamentalistische Entscheidung des amerikanischen Minimalismus mit sich. Mit Donald Judd, einem Kritiker, bevor er Bildhauer wurde (eine Qualifikation, die er hartnäckig ablehnte), der zugunsten einer von jeglichem Bezug zur realen Welt losgelösten Produktion in Lamentations: Part I erklärte: “Ich bevorzuge Kunst, die mit nichts in Verbindung gebracht wird”, was so weit ging, dass er seine Werke ohne Titel ironisch mit einfachen Definitionen wie The Bleaches umbenannte: mehr als Titel, Spitznamen. In diesem Sinne erklärte auch Robert Ryman: "Ich abstrahiere nicht von irgendetwas [...] Ich arbeite nicht auf einer gegenständlichen Basis [...] Kein Symbolismus. Kein Illusionismus“, wobei er sich sogar einen Spaß daraus machte, seine Bilder nach den verwendeten Farbmarken zu benennen. ”Als Rymans Ausstellung“, so Ianeselli, ”den Titel No Title Required trug, erreichte die Verachtung für Titel einen kritischen Punkt.



Die unbetitelte Sektion, mit der Francesco Stocchi die von ihm kuratierte Sektion der 18. Quadriennale d’arte nazionale di Roma, die derzeit im Palazzo delle Esposizioni stattfindet, (nicht) betitelt hat, sondern die von den Künstlern interpretiert wurde, hat eine lange Geschichte hinter sich. Diese geht auch auf die Arte Povera-Erfahrung von Germano Celant und Künstlern wie Giovanni Anselmo und Jannis Kounellis zurück, die systematisch das Untitled - in Kursivschrift, weil vomAlighero Boetti hingegen verließ sich auf die Tautologie, indem er die Materialien auflistete(Pietre e plate di metallo, 1968). Ein doc poverista wie Giuseppe Penone hingegen betitelte seine Skulpturen stattdessen: “Ich habe den Titel weiterhin benutzt, um die Lektüre des Werks zu lenken”, sagte der Künstler 2020 zu Chiara Ianeselli, "und um deutlich zu machen, dass das Werk nicht nur eine formale Untersuchung ist, sondern dass es einen Gedanken gibt, eine Idee, die durch den Titel identifiziert wird, wie Respirare l’ombra (Den Schatten atmen). Germano Celant, Theoretiker und Seele dieser Strömung in der italienischen Kunst, hatte sich 1969 in Arte povera hingegen klar über die Poetik des Arte povera-Künstlers, des idealen poverista, geäußert: “Seine Werke sind oft unbetitelt, fast so, als wolle er ein physisch-memotechnisches Zeugnis des Experiments erstellen und nicht eine Analyse oder Weiterentwicklung einer Erfahrung”. Schließlich haben die Paladine der Neo-Avantgarde von Celant nicht immer Pistolettos Markenzeichen geteilt. Und so fanden die nackten, rohen Dinge der Erde und der Industrie immer noch einen beschwörenden Namen, der sie geheimnisvoll, mythisch, einprägsam machte.
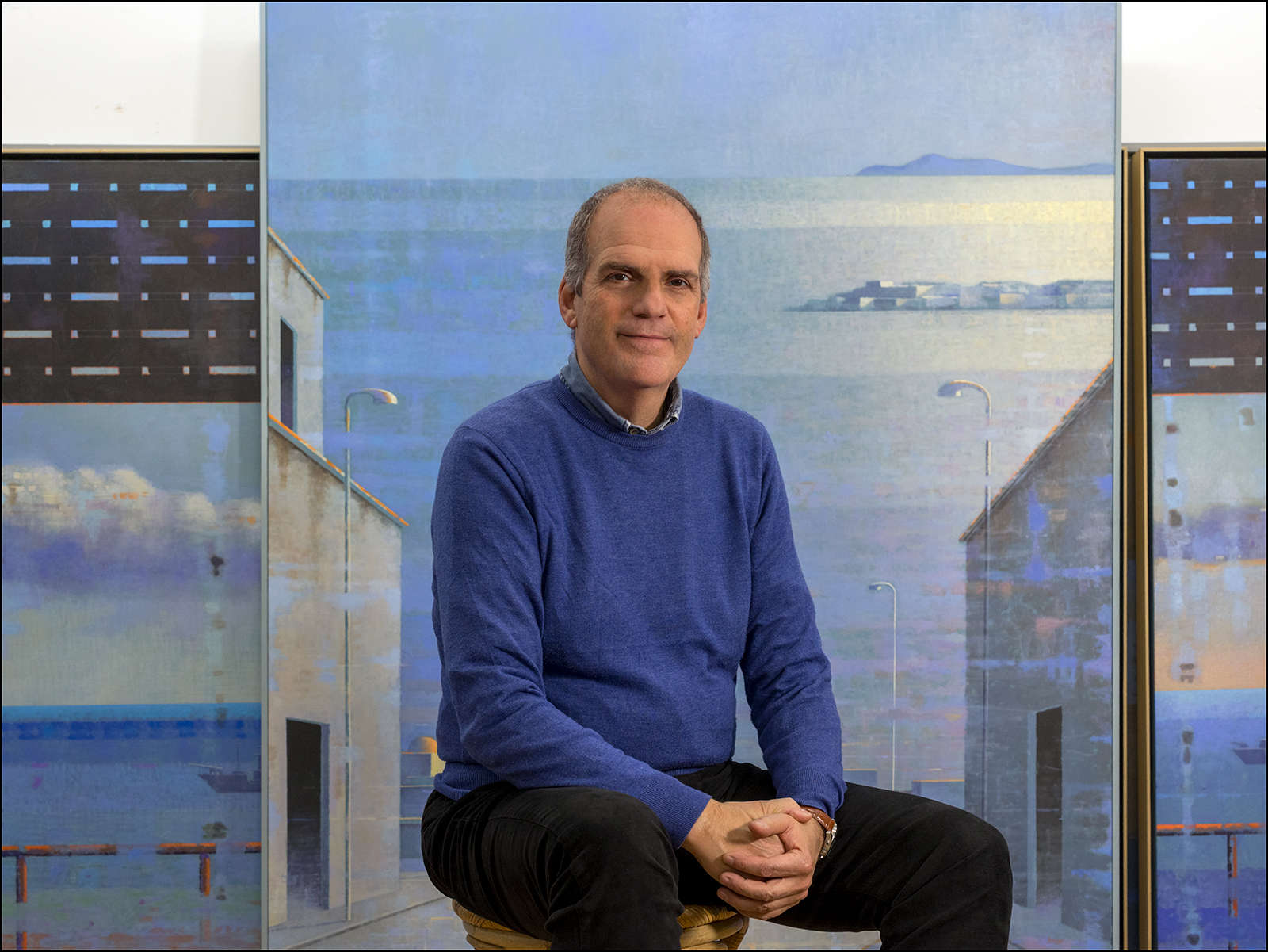
Der Autor dieses Artikels: Carlo Alberto Bucci
Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.